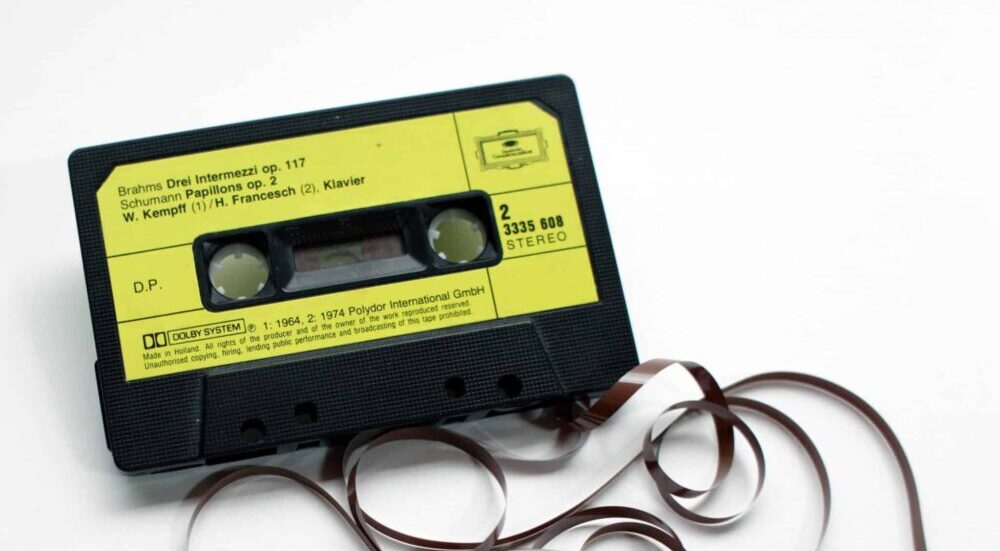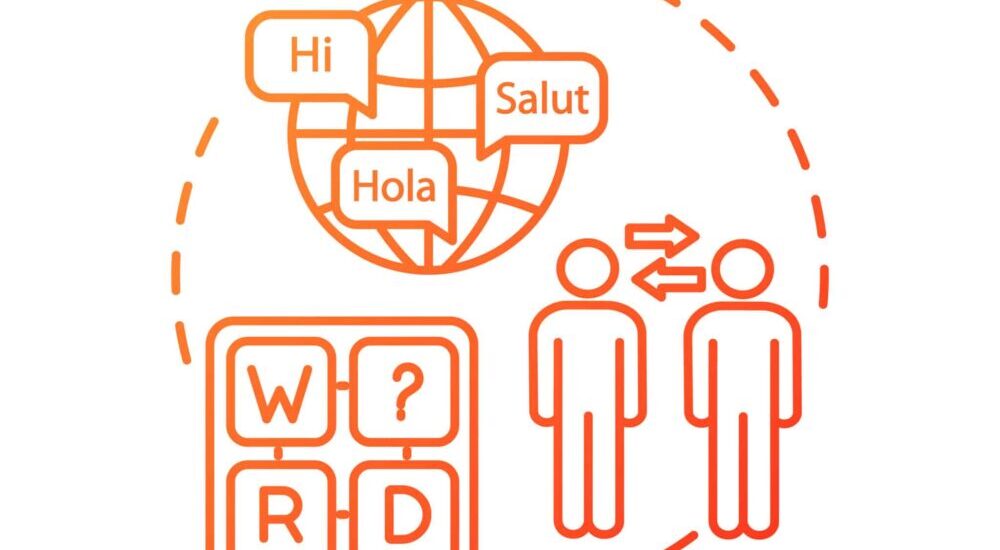Torhüter denken schneller - mit Augen und Ohren
Laut einer irischen Studie verarbeiten Torhüter Sinnesreize ganz anders als ihre Teammitglieder.

Als ehemaliger Torwart in der irischen NIFL Premiership hatte Michael Quinn einen Verdacht, den er als Student der Biopsychologie wissenschaftlich untersuchen wollte. Seiner eigenen Erfahrung nach waren Torhüter ganz eindeutig „komische Typen“ und zweifellos „anders als alle anderen“ auf dem Platz, wie es intuitiv, aber wenig wissenschaftlich schon der legendäre italienische Torwart Gianluigi Buffon ausdrückte.
„Im Gegensatz zu anderen Fußballspielern müssen Torhüter Tausende von sehr schnellen Entscheidungen auf der Grundlage begrenzter und unvollständiger sensorischer Informationen treffen“, schreibt Quinn auf der Website der Dublin City University zu seiner Studie. Erschienen in der internationalen Fachzeitschrift „Current Biology“, wird vom Erstautor darin die Hypothese aufgestellt, dass Torhüter Informationen aus verschiedenen Sinnesreizen ganz unterschiedlich und viel präziser verarbeiten können als ihre Teamkollegen.
Die meisten Menschen verbinden verschiedene Reize – Torhüter nicht
Für seine Studie versammelte er 60 Teilnehmer, alles Männer, die in drei verschiedene Gruppen eingeteilt wurden. Die eine bestand aus professionellen Torhütern, eine weitere aus professionellen Fußballern auf anderen Positionen und die dritte aus etwa gleichaltrigen Männern, die überhaupt nicht Fußball spielten. Alle Probanden nahmen dann an demselben Experiment teil, das folgendermaßen aussah: Getrennt voneinander wurden die Männer jeweils einem visuellen Reiz ausgesetzt, der aus einem oder zwei Blitzen bestand. Dazu kamen entweder ein Signalton, zwei Signaltöne oder gar keiner. In welchem zeitlichen Abstand die visuellen und akustischen Reize ausgelöst wurden, variierten die Wissenschaftler*innen. Die Versuchsteilnehmer wurden anschließend danach befragt, wie viele Blitze und Töne sie registriert hatten.
Das Ergebnis: Je weniger Zeit zwischen den unterschiedlichen Reizen lag, desto eher wurde deren Anzahl von den Probanden falsch angegeben. Der häufigste Fehler bestand darin, einen einzelnen Blitz, schnell gefolgt von zwei Tönen, als zwei Blitze und zwei Töne zu erinnern. Eine Gruppe aber unterschied sich deutlich von den beiden anderen: Die professionellen Torhüter waren in der Lage, die korrekte Anzahl von Blitzen und Tönen zu nennen. Ihr sogenanntes Bindungsfenster, als das das Zeitfenster definiert wird, in dem die Teilnehmer akustische und visuelle Reize gesondert voneinander wahrnehmen und in der Folge auch verarbeiten können, war deutlich kleiner als bei den anderen Gruppen. In dieser zugegeben kleinen Versuchsgruppe hatte sich die Hypothese damit bestätigt: Torhüter sind besser darin, verschiedene Sinnesreize voneinander zu unterscheiden, und damit auch besser gerüstet, um adäquat auf spontane Situationen reagieren zu können.
Die Flugbahn des Balls lässt sich aus verschiedenen Dingen ableiten
Eine Fähigkeit, die Quinn und sein Team aus einem bestimmten Grund mit den Sportlern in Verbindung bringen: Torhüter seien gezwungen, aufgrund von verschiedenen Sinnesreizen schnelle Entscheidungen zu treffen, die oft asynchron ablaufen. Um Richtung und Flug eines potenziell torgefährlichen Balls einzuschätzen, würden Torhüter einerseits darauf achten, wie genau der schießende Spieler zum Ball steht. Sei aber zum Beispiel die freie Sicht auf den Spieler verdeckt, könnten sie für ihre Einschätzung auch das Geräusch des geschlagenen Balls berücksichtigen und sich somit auf die akustischen Informationen konzentrieren.
Die Frage, die bleibt, ist laut dem Co-Autor und Psychologieprofessor David McGovern folgende: „Ist das engere zeitliche Bindungsfenster, das wir bei Torhütern beobachtet haben, auf das strenge Training zurückzuführen, das sie von klein auf absolvieren? Oder könnte es sein, dass die Unterschiede in der multisensorischen Verarbeitung eine angeborene, natürliche Fähigkeit widerspiegeln, die junge Spieler auf die Torwartposition zieht?“ Was davon zutrifft, wollen die Wissenschaftler*innen in weiteren Studien herausfinden.
Aufgrund der eigenen Erfahrung um eine Einschätzung der Studie gebeten, sah sich der DFB dazu nicht in der Lage. Gegenüber Audio Infos teilte der Pressesprecher der DFB-Akademie Jan Fedra lediglich mit, es handle sich bei der Studie um „ein spannendes Thema“, das die Trainer*innen für das Torwärter*innen-Spiel „interessiert verfolgen“. Solange der Einfluss des Trainings auf die Wahrnehmung aber nicht geklärt sei, sei es noch zu früh, um sich dazu zu äußern.
Torwärter*innen brauchen vor allem besondere kognitive Fähigkeiten
Florian Beck hat da weniger Bedenken. Der 46-Jährige ist seit Anfang 2023 Torwart-Trainer der Herrenmannschaft beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim und hält das Ergebnis der Studie für durchaus logisch. Denn neben einer gewissen Größe und Athletik sind es für ihn vor allem die kognitiven Fähigkeiten, die einen guten Torwart ausmachen. „Torwärter scannen ständig die verschiedenen Ebenen in einem Spiel“, sagte er gegenüber Audio Infos. Dieses müssten sie nicht nur quasi von hinten herauslesen können, sondern immer das Gesamtgeschehen im Blick haben und sich dementsprechend auch immer neu positionieren. Werde die Situation gefährlich, weil der Gegner sich der roten Zone nähere, blendeten Torwärter vieles aus und bekämen einen sogenannten Tunnelblick.
„Sobald der Fuß des angreifenden Spielers in Richtung Ball geht und er ausholt, scannt der Torwart ganz genau die Bewegung und schaut: Wie ist die Hüfte? Wie ist der Fuß und wie die Position?“ Die nötigen Informationen darüber, wie der Ball wahrscheinlich fliegen wird, würden Torwärter so schon in den Millisekunden begreifen, bevor der Fuß des Gegners den Ball überhaupt treffe. Torwart-Trainer Beck hält das Visuelle klar für den entscheidenden Faktor, der die Bedeutung auditorischer Reize in den Hintergrund treten lässt. In diesem Punkt widerspricht er also der These der Studie, wonach Torhüter sich sowohl auf das Geräusch des gespielten Balls konzentrieren können müssen als auch auf das Gesehene.
Torwärter blenden die Geräuschkulisse aus
Dazu komme Folgendes: Während man den Schuss während des Trainings noch hören könne, sei das bei Spielen im Stadion oft nicht mehr möglich. Bei mehreren Zehntausenden Zuschauer*innen sei die Geräuschkulisse einfach zu hoch und das zunehmend dann, wenn ein Spieler sich dem gegnerischen Tor nähert. Aus Erfahrung wisse er von seinen Torwärtern auch, dass sie akustische Reize, wie eben die Geräuschkulisse im Stadion, völlig ausblendeten. Dabei ist es in seinen Augen nicht so, dass auditorische Signale auf dem Platz keine Bedeutung haben. Das Gegenteil sei der Fall, wenn auch in einem anderen Zusammenhang als dem in der Studie hergestellten.
„Obwohl die Torwärter die Geräuschkulisse im Stadion komplett ausblenden, sind sie durchaus in der Lage, wichtige akustische Signale wahrzunehmen“, sagt Beck. Zur Verdeutlichung nennt er das Beispiel eines Torwarts, dem sich ein Stürmer nähert. In diesem gefährlichen Moment sei der Torhüter völlig auf das Visuelle konzentriert. Komme dann aber ein Abwehrspieler zur Verteidigung hinzu und rufe dem Torwart zum Beispiel zu, ob er das lange oder kurze Eck blocken solle, nehme er das sehr wohl wahr.
Im Training wird die Schärfung beider Sinne gezielt gefördert
Die Bedeutung, die beide Sinne getrennt voneinander für den Profi haben, zeigt sich in einem speziellen Training, das er zu deren Stärkung regelmäßig durchführt. Dass nämlich jeder Mensch ein dominantes Auge hat, nach dem sich das jeweils andere richtet, kann besonders bei Torhütern für Probleme sorgen. Bei Flanken von links oder rechts könnten sie die Flugbahn falsch einschätzen, weshalb Beck folgendes Ziel verfolgt: Bei seinen Torhütern soll bei einer Flanke von links das linke Auge dominant sein und bei einer Flanke von rechts das rechte.
Damit beide Augen gleich stark werden, trainieren die Torwärter jeweils abwechselnd mit einer Augenklappe. Dasselbe Prinzip wendet Beck mit Ohrstöpseln auch auf die Ohren an. Dass es für Torwärter*innen extrem wichtig ist, verschiedene Sinnesreize getrennt voneinander wahrnehmen und richtig einordnen zu können, steht für ihn jedenfalls außer Frage.
 Einloggen
Einloggen